BAG, Urteil vom 16.07.1997, Az.: 5 AZB 29/96 („Eismann“)
Franchisenehmer als arbeitnehmerähnliche Person/ Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten
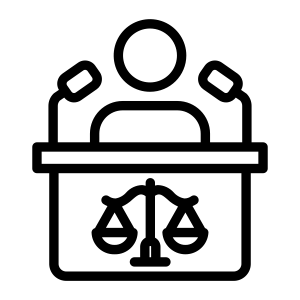
Leitsatz
1. Ob eine Partei Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnliche Person ist,
richtet sich ausschließlich danach, ob sie persönlich abhängig oder
zwar rechtlich selbständig, aber wirtschaftlich unabhängig und einem
Arbeitnehmer vergleichbar schutzbedürftig ist.
2. Daß ein Franchisenehmer den für ein solches Rechtsverhältnis
typischen Bindungen unterliegt, schließt die Annahme eines
Arbeitsverhältnisses nicht aus (entgegen OLG Schleswig, NJW-RR 1987, 220).
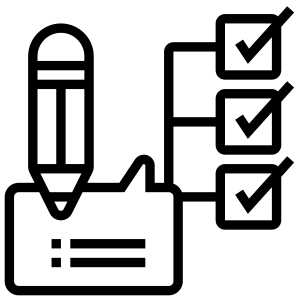
Zum Sachverhalt
Die Parteien streiten über die Zulässigkeit des Rechtswegs zu den
Gerichten für Arbeitssachen. Der Kläger war aufgrund schriftlichen
Vertrages vom 04.05.1993 als "Vertriebspartner" im Franchise-System
der Beklagten tätig. Der Kläger erhielt nach entsprechender Schulung
durch die Beklagte das Alleinverkaufsrecht für ein bestimmtes, für
ihn geschütztes Gebiet. Er hatte in eigenem Namen und auf eigene
Rechnung unter Nutzung der Marke der Beklagten deren Tiefkühlkost
unter Inanspruchnahme eines Einkäuferrabattes zu kaufen und im
Vertragsgebiet auf der Grundlage der jeweils gültigen Preisliste
der Beklagten an Haushalte und Endverbraucher zu vertreiben. Nach
der Präambel und nach I 5 11 des Vertrags hatte die Zusammenarbeit
"auf der Grundlage des Handbuchs" zu erfolgen, das "in seiner jeweils
gültigen neuesten Fassung Bestandteil des Vertrages" war. Dieses
Handbuch enthält detaillierte Regelungen über die bereitzuhaltende
Ware, die Aufstellung von Tourenplänen, die wöchentlichen Einsatzzeiten
(Tagestouren von Montag bis Freitag, der Sonnabend als Reservetag bzw.
als Tag für Büroarbeiten), Staupläne für das Tiefkühlfahrzeug sowie
zahlreiche weitere Durchführungshinweise.
Im Durchschnitt erhielt der Kläger in den letzten sechs Monaten
jeweils 2.600,39 DM ausgezahlt. Der Kläger kündigte den Vertrag mit
Schreiben vom 4.2.1995 zum 28.2.1995, die Beklagte kündigte den Vertrag
ihrerseits unter dem 16.3.1995 fristlos. Der Kläger begehrt die
Rückzahlung des Kostenbeitrags, eine Abfindung für die Aufbauleistung
und Entschädigung für das nachvertragliche Wettbewerbsverbot.
Das Arbeitsgericht hat den Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen
als eröffnet erachtet. Das Landesarbeitsgericht hat die allgemeinen
Zivilgerichte für zuständig angesehen und den Rechtsstreit an das
Landgericht verwiesen. hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner
weiteren sofortigen Beschwerde. Das BAG hielt den Rechtsweg zu den
Gerichten für Arbeitssachen für gegeben.
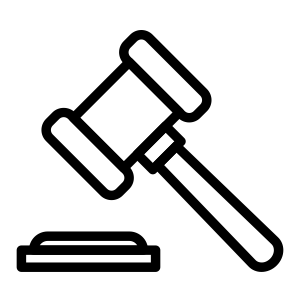
Die Entscheidung
1./2. Für die Klage ist der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen
eröffnet, wenn der Kläger im Verhältnis zur Beklagten Arbeitnehmer ist
(§ 5 I 1 ArbGG) oder wenn er als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen ist
und deshalb als Arbeitnehmer i. 5. des Arbeitsgerichtsgesetzes gilt (§ 5 I 2 ArbGG)
3. Entgegen der Ansicht des Klägers genügt im vorliegenden Fall die bloße
Behauptung, er sei Arbeitnehmer der Beklagten gewesen, nicht, um den
Rechtswegzu den Gerichten für Arbeitssachen zu eröffnen. Die bloße
Behauptung reicht nur dann aus, wenn die Klage nur Erfolg haben kann,
falls der Kläger Arbeitnehmerist, die den Rechtsweg und den materiellen
Anspruch begründenden Tatsachen alsoidentisch sind (BAG, Beschluß
v. 24.4. 1996 - 5 AZB 25195 - AP Nr.1 zu § 2 ArbGG 1979
Zuständigkeitsprüfung; BAG, Beschluß v. 9.10.1996 - 5 AZB 18/96 -
AP Nr.2, a.a.O.).
Dies trifft hier nicht zu. Die mit der Klage verfolgten Ansprüche können
auch dann begründet sein, wenn der Kläger nicht Arbeitnehmer der Beklagten
war. Als Rechtsgrundlagen kommen insbesondere die Regelungen im
Vertragswerk der Parteien i. V. mit den allgemeinen Bestimmungen des
bürgerlichen Rechts
in Betracht.
4. Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, der Kläger sei kein Arbeitnehmer der Beklagten gewesen.
b) Der Senat folgt dem nicht. Aus dem sogenannten Wesen des Franchise-Vertrags läßt sich nicht schließen, daß der Kläger kein Arbeitnehmer war. Es kommt nicht darauf an, wie ein Rechtsverhältnis bezeichnet wird, sondern welches sein Geschäftsinhalt ist (BAG, st.Rspr., zuletzt Urt. v. 12.9.1996 - 5 AZR 1066/94 - und - 5 AZR 104/95 -, zur Veröffentlichung auch in der Amtlichen Sammlung bestimmt). Es mag daher zutreffen, daß dem Franchising der Art, wie es hier praktiziert wird, genaue und detaillierte Anleitungen, Berichtspflichten des Franchisenehmers und Kontrollrechte des Franchisegebers immanent sind. Ob aber jemand, der in diesem System tätig wird, Arbeitnehmer oder Selbständiger ist, richtet sich allein danach, ob er weisungsgebunden und abhängig ist oder ob er seine Chancen auf dem Markt selbständig und im wesentlichen weisungsfrei suchen kann. Aus einer bloß verbalen Typisierung der Vertragsart läßt sich für die Frage der Arbeitnehmereigenschaft nichts herleiten. Der gegenteiligen Ansicht, wie sie vom OLG Schleswig vertreten wird (NJW-RR 1987, 220) vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Die Annahme, ein Franchisevertrag schließe die persönliche Abhängigkeit des Franchisenehmers per definitionem aus, beruht letztlich auf einem Zirkelschluß: Wenn und weil ein Franchise-Verhältnis in mehr oder weniger
vielen Punkten eine Einbindung, Eingliederung oder sogar eine gewisse
Weisungsgebundenheit des Franchisenehmers voraussetzt, soll dies die Annahme eines Arbeitsverhältnisses ausschließen, weil es sich um ein Franchise-Verhältnishandelt. Dies ist mit dem geltenden Recht nicht zu vereinbaren.
5. Ob dem Landesarbeitsgericht darin zu folgen ist, der Kläger sei tatsächlich
kein Arbeitnehmer gewesen, braucht nicht abschließend entschieden zu werden. Es spricht viel dafür, daß der Kläger Arbeitnehmer der Beklagten war. Hierauf kommt es aber letztlich nicht an. Der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen ist vorliegend schon deshalb eröffnet, weil der Kläger im Verhältnis zur Beklagten wegen seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit und seiner einem Arbeitnehmer vergleichbaren sozialen Schutzbedürftigkeit jedenfalls als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen ist und er deshalb als Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes gilt (§ 5 I 2 ArbGG). Eine nähere Klärung ist für die
Rechtswegbestimmung nicht erforderlich (BAG, NJW 1997, 1724).
a) Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, der Kläger sei nicht arbeitnehmerähnliche Person i. S. des § 5 I 2 ArbGG gewesen, weil die Parteien in einem Franchise-Verhältnis gestanden hätten und die ,,franchisetypischen Abhängigkeiten" der Annahme der Arbeitnehmerähnlichkeit entgegen stünden. Dem ist aus den oben (II 4 b) dargestellten Gründen zu widersprechen. Die Stellung einer Einzelperson als Franchisenehmer schließt es nach geltendem Recht gerade nicht aus, daß es sich hierbei um eine arbeitnehmerähnliche Person handeln kann.
b) Nach § 5 I 2 ArbGG gelten als Arbeitnehmer i. 5. des Arbeitsgerichtsgesetzes
"sonstige Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als
arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind". Das Arbeitsgerichtsgesetz
bestimmt selbst nicht, wer arbeitnehmerähnliche Person ist, sondern setzt den
Begriffsinhalt voraus. Arbeitnehmerähnliche Personen sind Selbständige, sie
unterscheiden sich von Arbeitnehmern durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit. Arbeitnehmerähnliche Personen sind in der Regel wegen ihrer fehlenden oder gegenüber Arbeitnehmern geringeren Weisungsgebundenheit, oft auch wegen fehlender oder geringerer Eingliederung in eine betriebliche Organisation in wesentlich geringerem Maße persönlich abhängig als Arbeitnehmer. An die Stelle der persönlichen Abhängigkeit tritt das Merkmal der wirtschaftlichen Abhängigkeit bzw. wirtschaftlichen Unselbständigkeit. Außerdem muß der wirtschaftlich Abhängige seiner gesamten sozialen Stellung nach einem Arbeitnehmer vergleichbar schutzbedürftig sein (BAG, Beschluß v. 11.4.1997 - 5 AZB 33/96-, zur Veröffentlichung bestimmt, unter III der Gründe; NJW 1997, 1724, unter III der Gründe; Beschluß v. 25.7.1996 - 5 AZB 5/96 - AP Nr.28 zu § 5 ArbGG 1979, unter II 2 der Gründe, jew. m. w. Nachw.). Dafür sind die gesamten Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung maßgeblich (BAG, Beschluß v. 11.4.1997, a.a.O., vgl. auch Hromadka, NZA 1997, 569).
c) Hieran gemessen war der Kläger; wenn nicht Arbeitnehmer; so doch eine
arbeitnehmerähnliche Person. Er war aufgrund seiner vertraglichen Bindung
wirtschaftlich von der Beklagten abhängig. Die Gestaltung des
Vertragsverhältnisses beanspruchte den Kläger derart, daß er daneben keine
nennenswerte weitere Erwerbstätigkeit mehr ausüben konnte. Die ,,Auszahlungen", die der Kläger von der Beklagten erhielt, lassen seine wirtschaftliche Abhängigkeit deutlich erkennen. Der Kläger war exklusiv an das Warensortiment der Beklagten gebunden. Die Reglementierung seiner Tätigkeit und seine zeitliche Beanspruchung ließen es nicht zu, sich weitere Erwerbschancen auf dem Markt zu suchen. Seine Einkünfte lagen im Bereich eines Zu-Verdienstes im eher unteren Bereich. Der Kläger war auch gleich einem Arbeitnehmer sozial schutzbedürftig. Er hatte sich gegenüber der Beklagten persönlich verpflichtet, als Franchise- bzw. Vertriebspartner im Vertriebsgebiet tätig zu sein. Er unterhielt keine eigene Unternehmens- oder Betriebsorganisation außer dem Lieferwagen, den er wiederum
von der Beklagten gemietet hatte, und er beschäftigte seinerseits jedenfalls
im Verkauf keine eigenen Arbeitnehmer. Er war wie ein angestellter Verkaufsfahrer tätig.
Wir sind für Sie da:
Dr. Prasse & Partner mbB Rechtsanwälte
Hamburg: 040 46655420
München: 089 71692463
Zürich: +41 43 508 91 73
Sitz der Gesellschaft:
Rathausplatz 9
22926 Ahrensburg
Telefon (0 41 02) 6 95 96-0
Telefax (0 41 02) 6 95 96-11
E-Mail: office@prasse-partner.de
Die anderen Kanzleien sind Zweigstellen der Rechtsanwälte
Dr. Christian Prasse und Michael Strotmann