BGH, Urteil vom 16.10.2002, Az.: VIII ZB 27/02
Zur Frage des Rechtswegs und zur arbeitnehmerähnlichen Person
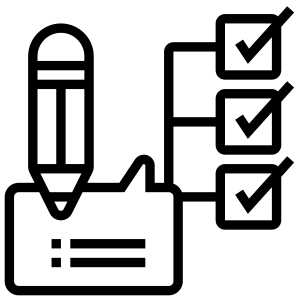
Zum Sachverhalt
Der Bundesgerichtshof hatte über die Beschwerde einer Franchisegeberin zu entscheiden, die ein Franchisesystem auf dem Sektor des Weinbverkaufs betreibt. Sie klagte gegen eine ehemalige Franchisenehmerin auf Zahlung für gelieferte Waren. Das Landgericht hatte sich für sachlich unzuständig erklärt und die Sache ans Arbeitsgericht verwiesen.
Die Beklagte (=Franchisenehmerin) hat die Zulässigkeit des Rechtsweges zu den ordentlichen Gerichten gerügt und die Ansicht vertreten, bei dem Franchisevertrag handele es sich faktisch um ein Arbeitsverhältnis; zumindest sei sie aber arbeitnehmerähnliche Person. Tatsächlich habe ihre Stellung derjenigen einer angestellten Verkäuferin entsprochen. Ihr sei weder im Bereich der Investitionen, der Produktpolitik, der Warenwirtschaft oder des betriebswirtschaftlichen Controllings eine eigenständige Entscheidungsfreiheit verblieben.
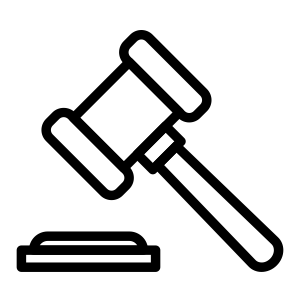
Die Entscheidung
Aus den Entscheidungsgründen:
Die Beschwerde der Beklagten ist nicht begründet.
Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, eine Zuständigkeit der Arbeitsgerichte sei nicht gegeben, da die Beklagte nicht Arbeitnehmerin gewesen sei. Der Arbeitnehmer unterscheide sich vom selbständigen Unternehmer durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit bei der Erbringung seiner Leistung. Während der Arbeitnehmer weisungsgebunden die vertraglich geschuldete Leistung im Rahmen einer von seinem Vertragspartner bestimmten Arbeitsorganisation erbringe, sei selbständig, wer im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen könne. ...
Die Beklagte habe weder einem umfassenden Weisungsrecht unterlegen, noch sei ihr Freiraum für die Erbringung der geschuldeten Leistung derart eingeschränkt gewesen, dass sie als Arbeitnehmerin anzusehen sei. Die sei berechtigt gewesen, Arbeitnehmer einzustellen. Urlaub habe sie sich nicht von der Klägerin genehmigen lasen, sondern ihr lediglich anzeigen müsse. Sie habe ihr Geschäft in eigener Verantwortung geleitet. Dass die Beklagte verpflichtet gewesen sei, ein bestimmtes Warengrundsortiment von der Klägerin zu beziehen, sei franchisetypisch und damit kein wesentlichen Indiz für eine Arbeitnehmereigenschaft. Die Beklagte sei auch nicht arbeitnehmerähnliche Person im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG. ...
Diese Ausführungen ... halten der rechtlichen Überprüfung stand.
...
Insoweit enthält § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB ein typischen Abgrenzungsmerkmal, das über den unmittelbaren Anwendungsbereich hinaus eine allgemeine gesetzgeberische Wertung erkennen lässt. Danach ist derjenige selbständig, der im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Unselbständig und persönlich abhängig ist derjenige Mitarbeiter, dem dies nicht möglich ist, weil er hinsichtlich Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Ausführung der versprochenen Dienste einem umfassenden Weisungsrecht unterliegt oder weil der Freiraum für die Erbringung der geschuldeten Leitung durch die rechtliche Vertragsgestaltung oder die tatsächliche Vertragsdurchführung stark eingeschränkt ist (st. Rspr., zuletzt BGH, Beschl. v. 27.1.2000 - III ZB 67/99, WM 2000, 638).
Die Beklagte war nach diesen Kriterien nicht Arbeitnehmerin. ...Die Beklagte war durch den Franchisevertrag hinsichtlich der Ausstattung der Räumlichkeiten an die Weisungen der Klägerin gebunden. Gleiches galt ...für Änderungen der Baulichkeiten und des Außenbereichs. Nicht zu beanstanden ist es, wenn insoweit das Beschwerdegericht ausführt, hierbei handele es sich um Vorgaben, die nicht als wesentlichen Indiz für ein umfassendes Weisungsrecht oder eine erhebliche Einschränkung des Freiraums für die Erbringung der geschuldeten Leistungen gewertet werden könnten. ...
Das Bundesarbeitsgericht geht ebenfalls davon aus, dass die konkreten Umstände des Einzelfalls für die Beurteilung des Rechtsverhältnisses maßgeblich sind. Es ist zu Recht der Ansicht, allein mit der Begründung, es liege ein Franchisevertrag vor, könne die Annahme eines Arbeitsverhältnisses nicht ausgeschlossen werden (vgl. BAG, Beschl. v. 16.7.1997, NJW 1997, 2973).
Auch die Verpflichtung der Beklagten, ein bestimmtes Warensortiment zum Zwecke der Vermarktung über die Klägerin zu beziehen, begründet keine persönliche Abhängigkeit im Sinne eines Arbeitsverhältnisses. Darüber hinaus war die Beklagte berechtigt, weiltere Waren von Dritten zu beziehen, die über das von der Klägerin angebotene Programm hinausgingen (Non-Food-Artikel). Dass sie hierfür der Genehmigung der Klägerin bedurfte, rechtfertigt sich daraus, dass ein Franchisekonzept darauf beruht, überall möglichst einheitliche Angebote präsentieren zu können , was einer gewissen Kontrolle bedarf. Nichts anderes gilt auch für die Tatsache, dass die Beklagte verpflichtet war, ausschließlich das von der Klägerin zur Verfügung gestellte Werbematerial zu verwenden ...
Dagegen brauchte die Beklagte ihre Pflichten zumindest nicht im vollem Umfang persönlich zu erbringen. Die Beklagte war berechtigt, Arbeitnehmer selbst einzustellen. Dass dies nur auf dem Papier stand, jedenfalls aufgrund er Verhältnisse ihres eigenen Geschäftsbetriebes wirtschaftlich nicht möglich gewesen wäre, hat die Beklagte nicht dargelegt. ...
Aus dem Umstand, dass die Beklagte verpflichtet war, das Ladengeschäft im Rahmen der gesetzlichen Ladenschlußzeiten möglichst lange offen zu halten, folgt gleichfalls nicht, dass sie als Arbeitnehmerin anzusehen wäre. [...] Denn über die Pflicht zum persönlichen Einsatz der Beklagten in diesem Zeitraumen ist nichts gesagt.
Sie war weiterhin in der Gestaltung ihrer Preise frei. Soweit die Beschwerde vorträgt, dies sei tatsächlich nicht der Fall gewesen, andere Franchisenehmer seien wegen ihrer Preisgestaltung von der Klägerin abgemahnt worden, kann dies nicht zu einer anderen Bewertung führen. Denn, wie das Beschwerdegericht richtig erkannt hat, entbehrte eine derartige Abmahnung jeder vertraglichen Grundlage. Die vertraglichen Regelungen können jedoch nicht unbeachtet bleiben. Ein Vertragspartner wird nicht dadurch zum Arbeitnehmer, dass ein Gegenüber ihm vertragswidrige Beschränkungen auferlegt.
Die Beklagte war auch nicht arbeitnehmerähnliche Person im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG. ... Vorliegend kann offen bleiben, ob die Beklagte von der Klägerin wirtschaftlich abhängig war. Zu Recht hat nämlich das Beschwerdegericht die soziale Schutzbedürftigkeit ... verneint.
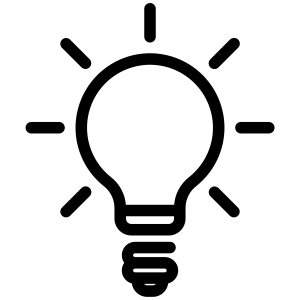
Fazit
Es handelt sich bei den Abgrenzungen und Einzelfallentscheidungen. Zumindest die arbeitnehmerähnliche Person wird in Einzalfällen beim Franchising zu bejahen sein. Dann wird der Rechtsstreit vor den Arbeitsgerichten verhandelt, jedoch ist allgemeines Zivilrecht anwendbar. Da das Arbeitsgericht sich in dieser Materie häufig nicht besonders gut auskennen dürfte, sollte auf Franchisenehmerseite genau abgewogen werden, ob die Verweisung eines Rechtsstreits an die Arbeitsgerichte beantragt werden sollte.
Das Landgericht hat gemäß § 17 a Abs. 3 Satz 2 GVG den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten für unzulässig erklärt und den Rechtsstreit an das Arbeitsgericht verwiesen. Auf die sofortige Beschwerde der Klägerin hat das Oberlandesgericht die Entscheidung des Landgerichts abgeändert, den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten für zulässig erklärt und die "weitere sofortige Beschwerde" zugelassen. Gegen diese ihr am 27. März 2002 Entscheidung richtet sich die von der Beklagten am 10. April 2002 eingelegte"weitere sofortige Beschwerde", die die Beklagte am 27. Mai 2002 begründet hat. Der BGH wies das Rechtsmittel als unbegründet zurück.
Wir sind für Sie da:
Dr. Prasse & Partner mbB Rechtsanwälte
Hamburg: 040 46655420
München: 089 71692463
Zürich: +41 43 508 91 73
Sitz der Gesellschaft:
Rathausplatz 9
22926 Ahrensburg
Telefon (0 41 02) 6 95 96-0
Telefax (0 41 02) 6 95 96-11
E-Mail: office@prasse-partner.de
Die anderen Kanzleien sind Zweigstellen der Rechtsanwälte
Dr. Christian Prasse und Michael Strotmann