BGH, Urteil vom 17.07.2002, Az.: VIII ZR 59/01 („Hertz I“)
Zur analogen Anwendbarkeit der Kündiungsfristen aus § 89 HGB auf Franchiseverträge
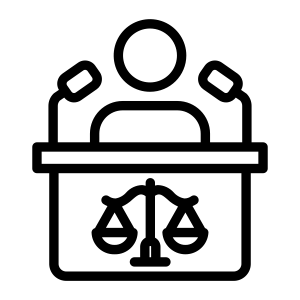
Leitsatz
Der BGH hatte sich mit Schadensersatzansprüchen einer Franchisenehmerin wegen der vorzeitigen Kündigung des Franchisevertrages zu befassen. Geklagt hatte jedoch zunächst das deutsche Tochterunternehmen der in den USA ansässigen Franchisegeberin. Die Franchisegeberin unterhält unter dem Warenzeichen "H. " mit Autovermietern weltweit Vertragsbeziehungen im Rahmen eines Franchise-Systems. Die Klägerin betreut die deutschen Franchisenehmer der Franchisegeberin, betreibt aber auch eigene Vermietungsstationen für Autos.
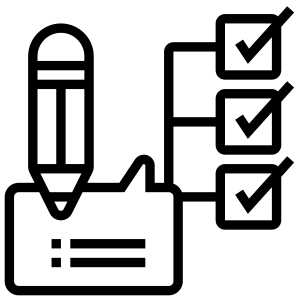
Zum Sachverhalt
Zwischen der Beklagten und der Drittwiderbeklagten bestanden seit 1984 in ständiger Folge jeweils auf zwei oder drei Jahre befristete und im Anschluß daran wieder neu abgeschlossene Franchise-Verträge, aufgrund derer die Beklagte eigene und der Klägerin gehörende Fahrzeuge unter dem Warenzeichen der Drittwiderbeklagten vermietete. Erst kurz vor Ablauf der festen Laufzeit -2 Wochen vor Ablauf- lehnte die Franchisegeberin die Ablehnung der Verlängerung per Schreiben ab. Der letzte Vertrag vom 28. Dezember 1993/31. Januar 1994 war bis zum 31. Dezember 1996 befristet. Mit Schreiben vom 16. Dezember 1996 teilte die Klägerin der Beklagten für die Drittwiderbeklagte mit, daß dieser Vertrag nicht verlängert werde. Die deutsche Tochtergesellschaft der Franchisegeberin wollte die Franchisenehmerin u. a. auf Unterlassung der Marke "H:" in Anspruch nehmen, da der Franchisevertrag von Franchisegeberseite aus nicht verlängert worden war. Die Beklagte widersetzte sich der Vertragsbeendigung, bemühte sich aber gleichzeitig um einen neuen Vertragspartner. Seit dem 1. April 1997 steht sie in Vertragsbeziehung zur Betreiberin eines anderen Autovermietungssystems. Sie erhob eine Drittwiderklage gegen die Franchisegeberin (=Drittwiderbeklagte). Soweit es für die Revision noch von Bedeutung war, klagte die ehemalige Franchisenehmerin darauf, - festzustellen, daß die Klägerin und die Drittwiderbeklagte ihr als Gesamtschuldner den Schaden zu ersetzen haben, der ihr durch die Nichtverlängerung des Vertragsverhältnisses über den 31. Dezember 1996 hinaus ohne Beachtung einer angemessene Umstellungsfrist von mindestens einem Jahr entstanden ist.
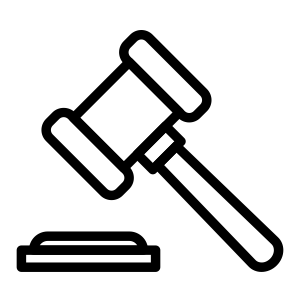
Die Entscheidung
Auszugsweise heißt es in den Urteilsgründen:
Auf den Franchise-Vertrag der Parteien findet § 89 HGB entsprechende Anwendung. Vorschriften des Handelsvertreterrechts sind auf einen Franchise-Vertrag entsprechend anwendbar, wenn der hinter einer Einzelbestimmung stehende Grundgedanke wegen der Gleichheit der Interessenlage auch auf das Verhältnis zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer zutrifft. Eine analoge Anwendung des § 89 HGB ist jedenfalls für das Franchiseverhältnis der Parteien gerechtfertigt. Die Beklagte befand sich nach den vertraglichen Vereinbarungen der Parteien hinsichtlichder Beendigung des Vertrages in derselben Interessenlage wie ein Handelsvertreter. Die Kündigungsfristen des § 89 HGB gewähren dem Handelsvertreter Schutzfristen, damit er sich für die Zeit nach Vertragsbeendigung um eine Tätigkeit für andere Unternehmer oder auf anderen Geschäftsfeldern umstellen kann. Die Notwendigkeit einer solchen Umstellungsfrist besteht bei einem Franchisenehmer zumindest dann, wenn er nach dem Vertrag seinen Geschäftsbetrieb weitgehend auf das Vertriebskonzept des Franchisegebers zuzuschneiden hat. So ist es hier. Die Beklagte hatte nach Nr. 3 A. und B. des Franchise-Vertrages ihr Vermietgeschäft ausschließlich in der Form des Standard-Vermietungsabkommens im Rahmen des H. -Systems durchzuführen.
Dazu gehörten neben der Verwendung der Standardverträge der Drittwiderbeklagten insbesondere die Benutzung des H. -Zeichens auf Mietfahrzeugen und Geschäftsunterlagen sowie die Gestaltung der Geschäftsräume in den "Standard H. Farben" und die Uniformierung des Personals nach den Vorgaben der Drittwiderbeklagten. Angesichts dieser umfassenden Eingliederung in das Franchise-System der Drittwiderbeklagten, die eine kurzfristige Umstellung auf ein anderes Vertriebskonzept nicht zuließ, müssen der Beklagten in gleicher Weise wie einem Handelsvertreter die Mindestfristen des § 89 HGB zugebilligt werden.
bb) Der Franchise-Vertrag der Parteien hätte daher trotz seiner Befristung bis zum 31. Dezember 1996 zum vereinbarten Ablauftermin nur durch eine Kündigung seitens der Drittwiderbeklagten unter Einhaltung der Fristen des § 89 HGB beendet werden können; denn die aufeinanderfolgenden Franchise-verträge der Parteien bildeten Kettenverträge, die als ein einheitliches unbefristetes Vertragsverhältnis anzusehen sind. Verträge zwischen denselben Parteien sind als Kettenverträge zu werten, wenn befristete Verträge mehrfach kurz vor oder kurz nach ihrem Ablauf mit den im wesentlichen gleichen Bedingungen verlängert werden, ohne daß diese Verträge jeweils erneut ausgehandelt werden (BGH, Urteil vom 11. Dezember 1958 - II ZR 169/57, VersR 1959, 129 unter 2.). Der Bundesgerichtshof hat solche im Zusammenhang stehenden befristeten Verträge mehrfach als ein einheitliches Vertragsverhältnis behandelt (vgl. Urteil vom 11. Dezember 1958, aaO; BGHZ 20, 30, 33 f.; Urteil vom 13. Dezember 1995 - VIII ZR 61/95, WM 1996, 877 = NJW 1996, 848 unter II 1 und 2; BGHZ 141, 248, 251). Der durch den engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang begründete Charakter eines einheitlichen Vertragsverhältnisses rechtfertigt es auch, die für unbefristete Verträge geltende Regelung des § 89 HGB auf Kettenverträge in der Weise anzuwenden, daß das Vertragsverhältnis nur dann mit dem vereinbarten Ablauf des letzten befristeten Vertrages endet, wenn es von einer Seite unter Einhaltung der Fristen des § 89 Abs. 1HGB, gerechnet ab dem Beginn des ersten Vertrages, zum Ablauftermin gekündigt wird, und sich andernfalls in ein unbefristetes Vertragsverhältnis verlängert. Die Parteien eines Kettenvertrages dürfen aufgrund der zwischen ihnen geübten Praxis darauf vertrauen, daß der Vertrag in gleicher Weise wie bisher verlängert wird. Sie sind in derselben Lage wie Vertragspartner, zwischen denen ein unbefristetes Vertragsverhältnis besteht und denen die unabdingbaren Kündigungsfristen des § 89 Abs. 1 HGB einen mit zunehmender Vertragsdauer größeren Zeitraum zubilligen, in dem sie sich auf die Vertragsbeendigung einstellen können. Der bis zum 31. Dezember 1996 befristete Franchisevertrag der Parteien hat sich somit mangels rechtzeitiger ordentlicher Kündigung innerhalb einer Frist von sechs Monaten (§ 89 Abs. 1 Satz 2 HGB) in ein unbefristetes Vertragsverhältnis verlängert. Aufgrund der erst mit Schreiben vom 16. Dezember 1996 erfolgten Ablehnung der Verlängerung, die als ordentliche Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgelegt werden kann, endete der Vertrag erst zum 30. Juni 1997. Die Drittwiderbeklagte hat deshalb zu Unrecht seit dem 1. Januar 1997 die Erfüllung des Franchise-Vertrages verweigert. ... Da die von der Drittwiderbeklagten geschuldete Beteiligung der Beklagten an ihrem Franchisesystem zeitbezogen war und deshalb nicht mehr nachgeholt werden kann, ist die Erfüllung ihrer Leistungspflicht mit Ablauf des 30. Juni 1997 unmöglich geworden, so daß die Beklagte nach § 325 Abs. 1 BGB a.F. (gemäß Art. 229 § 5 EGBGB in der am 31. Dezember 2001 geltenden Fassung) Schadensersatz wegen Nichterfüllung beanspruchen kann.
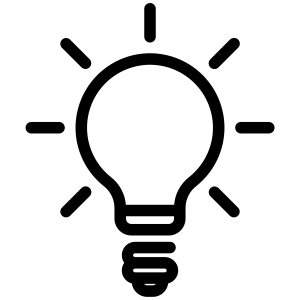
Fazit
In dem Rechtsstreit ging es auch um Auskunfts- und Auskehrungsansprüche des Franchisenehmers für Einkaufsvorteile. Zwischen der Klägerin und verschiedenen Autoherstellern bestehen Rahmenabkommen, auf deren Grundlage die Autohersteller sogenannte Werbekostenzuschüsse an die Klägerin zahlen, wenn Fahrzeuge ihrer Marke von der Klägerin oder von Franchisenehmern der Drittwiderbeklagten im Vermietungsgeschäft eingesetzt werden. Insoweit wurden die Widerklagansprüche der Franchisenehmerin zurückgewiesen. Jedoch hat der BGH in einem späteren Urteil über die Auskunftsansprüch erneut zu entscheiden gehabt; siehe BGH, Urteil vom 22. Februar 2006, Az.: VIII ZR 40/04 („Hertz II“)
Wir sind für Sie da:
Dr. Prasse & Partner mbB Rechtsanwälte
Hamburg: 040 46655420
München: 089 71692463
Zürich: +41 43 508 91 73
Sitz der Gesellschaft:
Rathausplatz 9
22926 Ahrensburg
Telefon (0 41 02) 6 95 96-0
Telefax (0 41 02) 6 95 96-11
E-Mail: office@prasse-partner.de
Die anderen Kanzleien sind Zweigstellen der Rechtsanwälte
Dr. Christian Prasse und Michael Strotmann